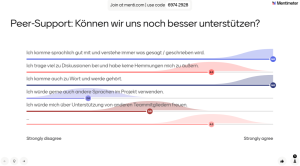2 Sprachwahl und -gebrauch im VA
Die sprachliche Gestaltung virtueller Austauschprojekte hängt maßgeblich von deren Zielen (s. Kap. 1.2), den verfügbaren Partner*innen sowie den individuellen Sprachkompetenzen der Beteiligten ab. Je nach Konstellation kann der Austausch entweder von einer oder zwei Sprachen dominiert werden oder eine offene Mehrsprachigkeit ermöglichen, in der alle verfügbaren Sprachen eingebracht werden können. Im Folgenden werden drei Ansätze vorgestellt, die in der VA-Praxis hinsichtlich der Wahl und Verwendung von Sprache(n) häufig Anwendung finden. Dabei werden ihre zentralen Merkmale herausgearbeitet, Potenziale anhand von Zitaten aus realisierten Projekten veranschaulicht und Impulse zur Reflexion über mögliche Herausforderungen gegeben.
2.1 Monolinguale Ansätze
Monolinguale virtuelle Austauschprojekte basieren auf der Nutzung einer primären Sprache als Kommunikationsmittel. Dies ist möglich, wenn alle VA-Teilnehmenden an den unterschiedlichen VA-Standorten auf die gleiche Erstsprache (bzw. Zweitsprache) zurückgreifen können, was aber gerade im internationalen Kontext selten der Fall ist. Daher wird hier oft eine Lingua Franca als VA-Sprache gewählt, die für einige oder alle Teilnehmenden eine Fremdsprache darstellt, aber eine gemeinsame Verständigung ermöglicht.
2.1.1 Prinzipien & Genese
Während VA ursprünglich vor allem in Sprachlernkontexten verbreitet war, d.h. primär mit sprachlichen Lernzielen verknüpft und meist zweisprachig ausgerichtet war (hier auch unter den Begriffen Telekollaboration oder e-Tandem), haben VA-Projekte, die über den Sprachlernkontext hinausgehen, in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung und Internationalisierung der Hochschullehre sowie angesichts globaler Herausforderungen, die kollaborative Lösungen erfordern, gewinnen transnationale VA-Projekte an Relevanz, die im Sinne einer Global Citizenship Education (UNESCO) darauf abzielen, vielfältige interkulturelle Begegnungen zu ermöglichen, Themen von hoher gesellschaftlicher Relevanz zu bearbeiten und Studierende dazu zu befähigen, aktiv an der Lösung globaler Probleme mitzuwirken (O’Dowd, 2020). In sprachlicher Hinsicht wird hierbei häufig eine Lingua Franca verwendet, also eine Sprache, die von allen Teilnehmenden als gemeinsame Verständigungsbasis genutzt werden kann. O’Dowd (2020: 480) hebt zudem Folgendes hervor:
“[…] from an educational perspective, it is also important to consider that today’s university graduates are increasingly likely to use a language such as English, not with native speakers, but rather with non-native speakers as a lingua franca in their future employment (Graddol, 2006). In the global workplace, engineers, computer scientists and other professionals will need intercultural and linguistic skills to use English for online collaborative work with other non-native speakers just as much, if not more, than with native speakers.”
Ein Lingua-Franca-Ansatz ermöglicht es, Studierende mit unterschiedlichsten sprachlichen Repertoires unter dem gemeinsamen Nenner einer Sprache – oft Englisch – zusammenzuführen, um Themen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten (MONOLINGUAL – LF). Voraussetzung dafür ist, dass alle VA-Partner:innen über ausreichende sprachliche Kompetenzen verfügen, um gleichberechtigt am Projekt teilnehmen zu können. Im akademischen Bereich hat sich hier seit den späten 1990er Jahren im US-amerikanischen Raum das COIL-Konzept etabliert. Es steht für Collaborative Online International Learning und wird von Rubin (2022) folgendermaßen charakterisiert:
“COIL utilizes the Internet to empower students and instructors around the world to develop curiosity, flexibility, and generosity in concert with their academic partners. This benefits two or more classrooms of collaborating students, usually located in different countries, who have had different life experiences. COIL is also a way for students and instructors to learn about their discipline from a new perspective and can be a method for engaging those with other experiences and perspectives about how this knowledge might be applied.” (Rubin, 2022: 7)
Einsprachige VAs sind neben den weit verbreiteten LF-Ansätzen, auch dann möglich, wenn der gemeinsame sprachliche Nenner keine Fremdsprache, sondern die Erst- oder Zweitsprache der Teilnehmenden ist (s. MONOLINGUAL – L1). Dies ist meist der Fall, wenn die Umgebungssprache aller Partnerinstitutionen die Gleiche ist (z.B. wenn Studierende aus Kolumbien und Spanien zusammenarbeiten).
Auch in VA-Projekten mit Sprachlernfokus, in denen eine Gruppe eine Fremdsprache lernt und eine andere Gruppe sie dabei in Form eines VAs unterstützt, kann die Sprachverwendung weitestgehend einsprachig sein (s. MONOLINGUAL L1/LX).
Im Folgenden soll der Lingua-Franca-Ansatz weiter fokussiert werden, da er die häufigste Art der einsprachigen Durchführung eines VA darstellt.
2.1.2 Ziele und Potenziale von VA mit LF-Charakter
Die folgenden Potenziale von VA sind mit Aussagen von VA-Teilnehmenden aus Projekten mit LF-Ansatz verknüpft, um die Vorteile dieses Sprachmodells zu illustrieren.
2.1.3 Herausforderungen
Der LF-Ansatz wird sowohl im akademischen als auch im schulischen Bereich vielfach verwendet. Die oben genannten Potenziale sind jedoch auch mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden, auf die in Kapitel 4 ausführlicher eingegangen wird. Machen Sie sich aber vorab selbst Gedanken dazu.
2. Aufgabe
Welche möglichen Schwierigkeiten in Bezug auf die Sprachverwendung im VA sehen Sie? Notieren Sie Ihre Gedanken dazu.
2.2 Bilinguale Ansätze
Ein zentrales Ziel zweisprachiger (bilingualer) VA ist die Kommunikation mit Sprecher*innen einer zu erlernenden Zielsprache. Die Teilnehmenden der Partnerinstitution sind jeweils Expert*innen (meist Erstsprecher*innen oder kompetente Zweitsprecher*innen*) einer Sprache, die für die andere Gruppe im Fokus von Sprachlernprozessen steht. Diese Beziehung ist meist reziprok, d.h. auch für die Expert*innen der einen Sprache ist die jeweils andere Sprache eine zu erlernende Fremdsprache (z.B. Projekt 4, Kap. 1.2).
* Während der Ursprungsidee zufolge die Zielsprache der einen gleichzeitig die Erstsprache der anderen Partner*innen ist, wird diese Orientierung am native speaker model zunehmend in Frage gestellt. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund der Zunahme an lebensweltlicher Mehrsprachigkeit. So sind z.B. zwei- (bzw. mehr)sprachige VA-Projekte möglich, in denen zwei Sprachen im Lernfokus stehen, die Partner*innen jedoch zum Teil keine Erstsprecher*innen der zu erlernenden Zielsprache sind. Hier ist der Übergang zu mehrsprachigen VAs fließend, wenn die Teilnehmenden z.B. ihr gesamtes Sprachenrepertoire in die Kollaboration miteinbringen.
2.2.1 Prinzipien & Genese
Bilinguale VA-Ansätze haben im Kontext fremdsprachlichen Lernens eine lange Tradition. Als Vorläufer können hier bereits Briefpartnerschaften erachtet werden, in denen Fremdsprachenlernende miteinander in der jeweiligen Fremdsprache kommunizierten. Auch das sogenannte Tandem- oder eTandemlernen nutzt die Idee der Lernpartnerschaft und zeichnet sich durch ein hohes Maß an Autonomie aus: Zwei Lernende treffen sich (face-to-face oder im Falle des eTandems virtuell) und bestimmen selbst, was sie (sprachlich) lernen wollen, wann, in welchem Umfang und auf welche Art. Bezüglich der Reziprozität wird meist eine zeitliche Aufteilung empfohlen – die Hälfte der Zeit gehört dem Partner / der Partnerin und deren Sprachlernbedürfnis. Sprache ist in diesem Fall Kommunikationsmedium, aber auch Inhalt, in dem z.B. sprachliche Besonderheiten oder Fehler der Partner*innen explizit thematisiert werden.
Zweisprachige VA bedienen sich oft eines der Tandemprinzipien, in dem die Teilnehmenden in Zweierteams zusammenarbeiten. Die Autonomie ist jedoch eingeschränkter, da VA stärker institutionell verankert und daher aufgabenbasiert, produktorientiert und von Lehrenden unterstützt organisiert ist. Die beiden Sprachen sollen dennoch möglichst gleichberechtigt zum Tragen kommen, Sprachwechselmodelle müssen von den Teilnehmenden ausgehandelt werden. Studien haben ergeben, dass in bilingualen Projekten folgende Sprachverwendungspraktiken zum Einsatz kommen (Feick / Knorr 2021a; b):
3. Aufgabe
Ordnen Sie die Zitate aus einem deutsch-neuseeländichen VA (Feick/Knorr 2021) als Beispiele den verschiedenen Modellen zu. Zum Sprachwechselmodell passen drei, jeweils eins für Zeit, Inhalt und Medium.
2.2.2 Ziele und Potenziale
Bilinguale VA-Projekte bieten Fremdsprachenlernenden eine Vielzahl an Potenzialen, die deren Lernprozess effektiv unterstützen können. Der folgende Überblick ist verknüpft mit Zitaten von Teilnehmenden an bilingualen VA-Projekten, die die Bandbreite an Vorteilen illustrieren.
2.2.3 Herausforderungen
Der bilinguale VA-Ansatz hat eine lange Tradition, besonders im Kontext des Fremdsprachenlernens. Die Zweisprachigkeit geht jedoch auch mit Herausforderungen einher, auf die in Kapitel 4 ausführlicher eingegangen wird.
4. Aufgabe
Welche möglichen Schwierigkeiten sehen Sie? Notieren Sie Ihre Gedanken dazu.
2.3 Mehrsprachige Ansätze
Angesichts steigender Mobilität, Migration und digitaler Vernetzung sowie der daraus resultierenden lebensweltlichen Mehrsprachigkeit (Gogolin 1994) werden zunehmend VA-Projekte realisiert, die den flexiblen und dynamischen Gebrauch mehrerer Sprachen ermöglichen und gezielt fördern. VA-Teilnehmende können dabei sowohl ihre Erst-, Zweit- als auch Fremdsprachen aktiv einbringen und zwischen verschiedenen Sprachressourcen wechseln.
2.3.1 Prinzipien & Genese
Forschung zu mehrsprachigen Praktiken, wie etwa translanguaging, zeigen, dass mehrsprachige Menschen situativ und flexibel zwischen verschiedenen Sprachen wechseln, um möglichst effektiv zu kommunizieren und Identität auszudrücken (vgl. García / Wei 2014). Auch das Prinzip der Interkomprehension spielt eine zentrale Rolle: Es bezeichnet die Fähigkeit, verwandte Sprachen zu verstehen, ohne sie aktiv zu beherrschen. Diese Kompetenz beruht auf sprachlichen Ähnlichkeiten sowie dem gezielten Einsatz von Strategien zur Erschließung unbekannter Wörter und Strukturen. Während die Nutzung anderer Sprachen beim Erlernen einer bestimmten Zielsprache lange Zeit als unerwünscht galt, wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass Mehrsprachigkeit beim Fremdsprachenerwerb nicht als Defizit, sondern als wertvolle Ressource zu betrachten ist, die aktiv in den Lernprozess integriert werden sollte. Dies wurde auch im Kontext mehrsprachiger virtueller Austauschprojekte untersucht. Die Studie von Grasz (2021) konnte z.B. zeigen, das Deutsch-Finnisch-lernende Tandempartner*innen neben ihren Zielsprachen (Deutsch und Finnisch) auch Englisch und Schwedisch nutzten, um z.B. lexikalische Lücken zu füllen, Verständnisprobleme zu überwinden, komplexe Themen zu diskutieren oder sprachliche Fragen zu klären. Ein solcher mehrsprachiger Ansatz kann Sprachängste reduzieren, Sprachbewusstsein schärfen sowie die Eigenverantwortung der Lernenden stärken.
Neben Projekten, in denen die Partner*innen mehrere Sprachen flexibel nutzen, zeichnen sich andere Projekte mit einem Fokus auf Mehrsprachigkeit dadurch aus, dass Mehrsprachigkeit als Thema im Zentrum steht (z.B. LiLLA, Feick / Knorr 2021a, b). In anderen Projekten werden mehrsprachige Materialien verwendet und Aufgaben mehrsprachig angeboten (z.B. Schneider 2019), auch wenn die Sprache, die die Teilnehmenden für die Kollaboration verwenden, eine gemeinsame (von den Teilnehmenden ausgehandelte) Lingua Franca ist. Die unterschiedlichen Ansätze verbindet das Ziel, Mehrsprachigkeitsbewusstheit zu fördern, indem sie ein Bewusstsein für die Vielfalt und den Wert von Sprachen schärfen, einen respektvollen Umgang mit Mehrsprachigkeit unterstützen, eine sozialkritisch-reflektierte Haltung in Bezug auf Machtverhältnisse und Ungleichheiten im sprachlichen Bereich und Strategien für effektive mehrsprachige Praktiken vermitteln.
2.3.2 Ziele und Potenziale
2.3.3 Herausforderungen
Die von VA-Teilnehmenden unter 2.3.2 formulierten Potenziale sind auch mit Herausforderungen verbunden, auf die in Kapitel 4 ausführlicher eingegangen wird.
5. Aufgabe
Welche möglichen Schwierigkeiten sehen Sie in Bezug auf mehrsprachige VA-Praktiken? Notieren Sie Ihre Gedanken dazu.
Alle Illustrationen auf dieser Seite von @storyset (https://www.freepik.com/author/stories)
This work © 2025 by Petra Knorr is licensed under CC BY-NC-ND 4.0