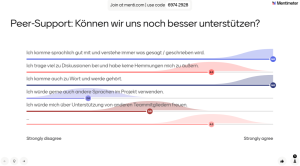Kulturelle Aspekte
Modulziele:
- Sie kennen die Notwendigkeit kultureller Aspekte in VA und können diese beurteilen.
- Sie kennen die Komplexität des Kulturbegriffs und können die Problematik des Interkulturalitätsparadigmas einschätzen.
- Sie können kulturalistische Zuschreibungen (auch eigene) (selbst)kritisch reflektieren.
- Sie können Lehrziele kulturellen Lernens beschreiben.
- Sie entwickeln eine Offenheit gegenüber komplexen und ambivalenten Themen und Problemstellungen.
1. Einstieg
“In the area of university foreign language education, OIE [Online Intercultural Exchange] has become to be seen as one of the main tools for developing intercultural awareness in the language classroom (Corbett, 2010; Thorne, 2006) as it allows educators to engage their learners in regular communication with members of other cultures in distant locations, and it also gives learners the opportunity to reflect on and learn from the outcomes of this intercultural exchange (…).” (Lewis & O’Dowd, 2016, S. 3)
Die ersten Projekte im Virtuellen Austausch waren rein kulturbezogen und auch in der Fremdsprachenausbildung sind der Erwerb fremdsprachlicher und interkultureller Kompetenzen von Beginn an eng verwoben (siehe u.a. Lewis & O’Dowd, 2016). So werden unterschiedliche virtuelle Austauschformate, angefangen bei E-Tandem- und Telekollaborationsprojekten, genutzt, um die sprachlichen und (inter)kulturellen Kompetenzen Sprachlernender (weiter) zu entwickeln. Das zeigen auch empirische Studien. So beschreibt O’Dowd in einer Analyse von 365 Lernportfolios, dass die Studierenden durch die Teilnahme an VA eine größere Offenheit gegenüber anderen Kulturen entwickeln (nach O’Dowd: 2021, S.7). Wie wir sehen, es gibt Forschung zu dem Thema, und zwar bereits von Beginn an. Eine dezidierte Zielsetzung bzw. Fragestellung fehlt allerdings, da die Begrifflichkeiten oft unscharf sind. So scheint es oft um eine Gegenüberstellung des “Eigenen” und “Fremden”, der “einen Kultur” gegenüber einer “anderen Kultur” zu gehen. Dies verdeutlicht, dass wir es scheinbar auch hier mit dem sehr verbreiteten, vereinfachten Narrativ zu tun haben, dass sich Kulturen mit Nationen gleichsetzen und mehr oder weniger klar voneinander abgrenzen und beschreiben lassen.

Doch: Was bedeutet ‘interkulturelles Lernen/interkulturelle Kompetenz’ eigentlich? Und: Wovon sprechen wir, wenn wir von ‘Kultur’ sprechen? Diesen Fragen werden wir in diesem Modul nachgehen. Hierfür ist es zunächst einmal notwendig, den Kulturbegriff kulturtheoretisch zu fundieren und sich mit dem Interkulturalitätparadigma kritisch auseinanderzusetzen. Im nächsten Schritt werden wir beispielhaft Projekte und Methoden, die sich für ‘kulturelles Lernen’ im Virtuellen Austausch eignen, genauer betrachten.
1. Aufgabe
Sehen Sie sich folgende Beispiele an. Diese Beispiele sind fiktiv, basieren aber auf Beobachtungen diverser Studien.
Überlegen Sie: Handelt es sich hierbei um ein (inter)kulturelles Problem? Warum/Warum nicht?
Nehmen Sie sich ein Beispiel heraus und notieren Sie, wie Sie mit dieser Herausforderung umgehen würden. Wir werden im Laufe des Moduls erneut auf diese und ähnliche Beispiele zu sprechen kommen.
VA Japan – USA:
In unserem Seminar fiel auf, dass die japanischen Studierenden oft lange Pausen machten und einfach nichts sagten. Um diese Stille zu überbrücken, sprachen die amerikanischen Studierenden dann einfach weiter. Das verunsicherte die japanischen Studierenden.
VA Schweden – Spanien
In unserem VA hatten wir WhatsApp-Gruppen, in denen wir uns über die Seminarinhalte austauschten. Die spanischen Studierenden schickten darin auch Küsschen-Emojis und tauschten sich über persönliche Dinge aus, was die schwedischen Studierenden sehr irritierte.
VA USA – Deutschland
Thema unseres VA waren die Anschläge auf ein Gymnasium in Deutschland bzw. eine Highschool in den USA. Wir haben uns in der Gruppe über Waffengesetze gestritten und es wurde viel verallgemeinert. Zwischendurch waren wir alle sehr frustriert.
Was hier als (inter)kulturelles Problem beschrieben wird, könnte unterschiedliche Ursachen haben:
Zum Beispiel könnte eine Ursache sein, dass wir es hier mit unterschiedlichen institutionellen Gepflogenheiten zu tun haben. Möglicherweise ist es im Seminar der japanischen Studierenden gewünscht, erst einmal in Ruhe nachzudenken. Zum anderen können auch sprachliche Unsicherheiten Grundlage für das oben beschriebene ‘Problem’ sein.
In diesem Beispiel wird die Verwendung von sehr persönlichen Emojis und persönlichen Themen im universitären Kontext beschrieben. Auch hier handelt es sich um unterschiedliche Kommunikationsstile. Auch institutionelle Gepflogenheiten können eine Rolle spielen.
Ein schwieriges und konfliktreiches Thema wird oft als (inter)kulturell herausfordernd betrachtet. Dabei wird es vor allem schwierig, wenn Verallgemeinerungen und Stereotype Argumentationsgrundlage sind. Problematisch ist an dieser Stelle also, wie über etwas gesprochen wird.
Wichtig in VA ist das Onboarding. Besprechen Sie mit ihren Studierenden Regeln der Kommunikation. Schaffen Sie einen Raum, in welchem eine Atmosphäre herrscht, in der (sprachliche) Fehler erlaubt sind.
Mehr dazu in Kap. 11.3
Wichtig in VA ist das Onboarding. Besprechen Sie mit ihren Studierenden Regeln der Kommunikation, z.B. an einem Beispiel wie diesem hier. Erarbeiten Sie mit ihren Studierenden eine für ihren VA geltende Netiquette. Greifen Sie in festen Reflexionsphasen mögliche Kommunikationsprobleme auf und reflektieren Sie diese gemeinsam mit ihren Studierenden.
Mehr dazu in Kap. 11.3
Auch dieses Beispiel zeigt, wie wichtig Kommunikationsregeln sind. Legen Sie gemeinsam mit ihren Studierenden Regeln, auch im Umgang mit Themen, fest, z.B. wenn plötzlich ein anderes Themenfeld an Wichtigkeit gewinnt. Führen Sie feste Reflexionsphasen ein, in welchem ‘Probleme’ kommuniziert und offen diskutiert werden können.
Alle Illustrationen auf dieser Seite von @storyset (https://www.freepik.com/author/stories)
This work © 2025 by VE-Collab is licensed under CC BY-NC-ND 4.0