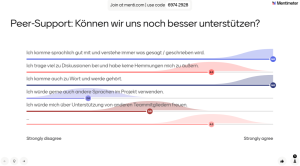2. Was heißt "Kultur"?
Bei Kultur handelt es sich um “einen der schlimmsten Begriffe, die je gebildet worden sind“
(Luhmann 1995c: 398)
Dieser vielzitierte Ausspruch Luhmanns verdeutlicht, dass es eben nicht so einfach ist, über ‘Kultur’ zu sprechen. Im Gegenteil: Kultur ist ein äußerst vielschichtiger und komplexer Begriff, er hat eine lange Geschichte der begrifflichen Auseinandersetzung und wird aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven verschieden fokussiert. Wir wollen uns diesem schillernden Begriff in diesem Kapitel ein wenig annähern.
Virtuelle Austausche eröffnen eine wertvolle Möglichkeit, globale Themen und lokale Besonderheiten in einem internationalen Kontext zu diskutieren. Auch ‘kulturelle’ Themen eignen sich hervorragend für virtuelle Austausche, da Studierende aus unterschiedlichen Ländern direkt miteinander kommunizieren und ihre Perspektiven austauschen können, um so ihre kulturelle Kompetenz zu erweitern.
Doch: Was heißt eigentlich ‘Kultur’? – ein Wort, ein Begriff, der vielseitig gebraucht ist und von dem wir ausgehen, dass ihn alle verstehen. Oder ist Kultur nicht doch einer der schlimmsten Begriffe, wie Luhmann meint?
Bevor wir uns aus kulturtheoretischer Sicht mit dem Thema beschäftigen, stellen Sie sich bitte folgende Situation vor:
Sie starten ein neues VA-Seminar, an welchem Studierende aus Italien, Frankreich, China und den USA teilnehmen. Sie überlegen, welches Thema ein guter Icebreaker für die erste Seminarsitzung wäre und entscheiden sich für das Thema ‘Essen’.
Sehen Sie sich die folgenden drei Fragen an. Alle drei Fragen behandeln dasselbe Thema, haben aber vollkommen unterschiedliche Implikationen. Überlegen Sie, welche Implikation jede Frage haben könnte.

Durch das ‘man’ ist die Frage unpersönlich und damit sehr verallgemeinernd. Das ‘Ihnen’ zielt darauf ab, zu homogenisieren, da ‘Ihnen’ höchstwahrscheinlich die Nation meint, in welcher sich die Person aufhält. Darüber hinaus erhält der/die Gefragte auf diese Weise einen ‘Expert*innen’-Status für ‘sein/ihr’ Land.
Oft werden durch eine solche Fragestellung Stereotype reproduziert, z.B. “Bei uns isst man Spaghetti”.
Diese Frage spricht die Person direkt an und ist somit sehr persönlich und individuell. Da aber keine weitere Auseinandersetzung erforderlich ist, bleibt die Aufgabe sehr oberflächlich.
Auch hier wird nach der Subjektposition gefragt. Die Person soll aber darüber hinaus den eigenen Standpunkt vertreten und lernt auch, andere Standpunkte zu verstehen (und vielleicht zu hinterfragen).
Idealerweise wird hier ein Diskursfeld eröffnet, d.h. das Subjekt greift bei der Argumentation auf weitere Texte (Artikel, Filme etc.) zurück.
Schon dieses einfache Beispiel zum Thema ‘Essen’ zeigt, wie unterschiedliche Fragestellungen
- meinen Lernenden unterschiedliche Funktionen zuschreiben (Stellvertreter*in für ein Land vs. Subjektposition)
- bestimmte Konzepte von ‘Kultur’ evozieren
Oft werden hierbei auch Stereotype und Zuschreibungen evoziert. So wird zum Beispiel das Bild von Deutschland oft auf das Stereotyp Bier, Weißwurst/Bratwurst und Lederhose reduziert – aber dass dieses Bild nicht auf alle Deutschen, sondern eher nur auf einen marginalen Teil der Bevölkerung zutrifft, sollte offensichtlich sein.
Warum gibt es dennoch Stereotype und inwiefern können Sie nützlich, aber auch gefährlich sein – dieser Frage wenden wir uns nach folgender Aufgabe zu.
2.3 Stereotype und Zuschreibungen
Reflexionsaufgabe:
Wenn Sie möchten, laden Sie ein Foto mit einer Person auf folgender Webseite hoch: https://theyseeyourphotos.com/
Die Anwendung soll zwar vorrangig dafür sensibilisieren, was Google mit ihren Bildern alles macht, zeigt aber auch sehr anschaulich, wie eine spezielle KI die enthaltenen Objekte im Bild wie Menschen, Kleidung oder Fahrzeuge klassifiziert und ihnen eine Bedeutung zuweist. Bei allen Bildern, auf denen Menschen abgebildet waren, hat Google Vision beispielsweise beschrieben, dass es sich um eine Frau/einen Mann handle, welche ethnische Zugehörigkeit diese/dieser habe, wie alt sie ungefähr sei und welcher sozialen Schicht sie angehöre uvm. – ganz ähnlich dem, wie wir Menschen kategorisieren, wenn wir sie sehen.
Stereotype lassen sich im Rahmen einer Minimaldefinition als mentale Vereinfachungen komplexer Eigenschaften oder Verhaltensweisen von meist nationalstaatlich definierten Personengruppen beschreiben (Fornoff: 330)
Sie gehören also zu den Ordnungsmechanismen unserer Wahrnehmung und helfen zum einen bei der Orientierung in der Welt. Zum anderen dienen sie uns aber auch dazu, uns mit unseren eigenen Gruppenzugehörigkeiten zu identifizieren.
Zu beachten gilt hierbei, dass Stereotype in ihrer Einfachheit fehlerhaft sein müssen und damit der Komplexität von Menschengruppen und Identitäten nicht gerecht werden können. Darüber hinaus sind sie dadurch leider auch die Grundlage von Vorurteilen, Diskriminierungen und Stigmatisierungen. Aber: Man kann mit Ihnen auch sehr gut arbeiten, wie Krengel im Modul Controversiality in VE in Kapitel 3. (De-) Constructing Stereotypes anschaulich herausarbeitet.

Obwohl oder gerade weil unser menschliches Gehirn zur Generierung von Verallgemeinerungen konzipiert ist, ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein und diese Vorgänge zu hinterfragen. Es ist essenziell, sich der ersten Eindrücke bewusst zu werden und diese nicht unhinterfragt zu akzeptieren. Stattdessen sollte eine Offenheit für das Individuum und das Einzigartige entwickelt werden. Im VA verhält es sich mit Stereotypen ähnlich. So können sie zwar das Verständnis der Lernenden für unbekannte Verhaltensmuster erleichtern, sie können aber auch leicht zu Intoleranz gegenüber Mitglieder*innen anderer Gruppen führen und die Kommunikation behindern.
Doch wie entstehen Stereotype eigentlich? Sie werden auf der Grundlage verschiedener Arten von Informationen über das andere Land gebildet: Dazu gehören Informationen aus den Massenmedien, Werbung und Erfahrungen aus Begegnungen. Auch die Physis kann die Bildung von Stereotypen oder Zuschreibungen beeinflussen. Einmal gebildete kulturelle Stereotypen lassen sich nicht so leicht ablegen. Wie Kramsch (1993: 210) argumentiert, sind Stereotype „hartnäckig“ und können selbst dann noch verstärkt werden, wenn sie durch direkte Interaktion mit Personen der ‘Zielkultur’ widerlegt werden und sich als falsch erwiesen haben. Es ist daher möglich, dass Lernende während solcher Projekte Stereotypen verstärken, wenn sie neue Informationen über die Zielkultur von deren Muttersprachler*innen erhalten, anstatt differenziertere Ansichten zu entwickeln. Um eine vielfältige und sensible Sichtweise auf die sogenannte ‘Zielkultur’ zu fördern, ist es daher notwendig zu verstehen, wie kulturelle Stereotypen gebildet werden und wann sie in bestimmten Lernkontexten verworfen, verändert oder verstärkt werden können (nach Itakura: 39).
Ein weiterer wichtiger Aspekt, gerade im Fremdsprachenkontext, ist die Rolle der Lehrenden und L1-Sprecher*innen der sogenannten ‘Zielkultur’. Kern (2014) schreibt dazu: “The problem is, what a cultural representative meant in the 1980s is quite different from what it means in today’s globalized world, where language, place, and community can no longer be assumed to go together” (p. 351) (zit. n. O’Dowd 2012: 3).
Das bedeutet konkret: Es muss zu Beginn eines VA thematisiert werden, dass die jeweiligen Gruppen (Studierender und Lehrender) keine Repräsentant*innen einer bestimmten Kultur darstellen. Darüber hinaus müssen die Gruppen dafür sensibilisiert werden, wie wirkmächtig einzelne Äußerungen sein können. Idealerweise werden Gruppendiskussionen im Plenum gemeinsam reflektiert, sodass darüber diskutiert werden kann, wie einzelne Äußerungen gedeutet werden können. Hierzu unten in Kapitel 2.2 mehr.
Doch wie geht man nun mit Stereotypen und Zuschreibungen im VA um?
“Ein offenes Thematisieren z.B. von Stereotypen sowie provokante Zugänge zu kontroversen Themen, welche ggf. unterschiedliche kulturelle Wahrnehmungen sicht- und erlebbar machen, wurden (…) als förderlich bewertet” (Braselmann/Kramer: 122).
Wenn Sie sich tiefergehend mit diesem Thema auseinandersetzen möchten, besuchen Sie gerne unsere Lerneinheit zu (De-)Constructing Stereotypes.
2.1 Kulturbegriffe
Der etymologische Kern von Kultur liegt bei dem lateinischen Verb colere, was ‘pflegen’, ‘anbauen’, ‘pflügen’ in agrarischen Kontexten bedeutet. Colere steht also dafür, dass etwas von Menschenhand erschaffen oder geformt wird. Es steht somit im Gegensatz zur Natur, also etwas, das einfach ist.
Wie die historische Entwicklung des modernen Kulturbegriffs, so ist auch die Gegenwart von einer Vielzahl unterschiedlicher Ansätze geprägt, die jeweils ihre eigenen Vorstellungen von Kultur hervorgebracht haben.

Einen guten Überblick über die Vielzahl der in Gesellschaft und Wissenschaft kursierenden Kulturbegriffe liefert die des Soziologen Andreas Reckwitz entwickelte “Typologie des Kulturbegriffs” (Reckwitz 2000):
„’Kultur’ stellt in dieser Bedeutung nichts Wertfreies, rein Deskriptives dar, sondern umschreibt eine in irgendeiner Weise ausgezeichnete, erstrebenswerte Lebensweise. […] Kultur ist der normativ ausgezeichnete Zustand einer sozialen Gemeinschaft […]. Wenn der Zustand der Kultur als erstrebenswert angenommen wird, so gilt dies für die Menschheit allgemein. Nicht die Voraussetzung von ‘Kulturen’ im Plural (wie später im totalitätsorientierten Kulturbegriff), sondern von Kultur im Singular ist charakteristisch für die normative Kulturvorstellung.“ (Reckwitz 2000: 65f)
Beispiele:
- Kultivierung
- Esskultur
- Kulturbeutel
- die zivilisierte Welt
- die Wilden vs. die Zivilisierten
- unkultiviert
Kritik:
- stark wertend
- historisch belastet
Kultur im Sinn des differenzierungstheoretischen bzw. sektoralen Kulturbegriffs ist das „gesellschaftliche Handlungsfeld, in dem die Produktion, Verteilung und Verwaltung von ‘Weltdeutungen’ intellektueller, künstlerischer, religiöser oder massenmedialer Art stattfindet. Kultur ist dann nichts anderes als ein soziales ‘Teilsystem’, das sich in institutionalisierter Form auf den Umgang mit Weltdeutungen spezialisiert hat.“ (Reckwitz 2000: 79)
Beispiele:
- Kulturabteilung
- Kultursoziologie
- Kulturbanause
- Kulturpolitik
- Kulturredakteur
Kritik:
bezieht sich nur auf Artefakte (Kunst)
- die deutsche Kultur
- fremde Kulturen
- kulturelle Unterschiede
- interkulturell
- zu stark homogenisierend und pauschalisierend
- unterstützt stereotypisches Denken und kulturalistische Zuschreibungen
„… wird Kultur [in modernen Kulturtheorien] nicht als ein (insbesondere ästhetisches) Subsystem der Gesellschaft oder in Herderscher Tradition als die Totalität einer gesamten, von Menschen ‘gemachten’ Lebensform verstanden. Kultur erscheint vielmehr nun als jener Komplex von Sinnsystemen oder […] von ‘symbolischen Ordnungen’, mit denen sich die Handelnden ihre Wirklichkeit als bedeutungsvoll erschaffen und die in Form von Wissensordnungen ihr Handeln ermöglichen und einschränken.“ (Reckwitz 2000: 84)
Der linguistc turn Mitte des 20. Jahrhunderts leitet einen Paradigmenwechsel in den Sozial-und Geisteswissenschaften ein: Die Welt ist nicht objektiv gegeben, sondern immer schon sprachlich konstruiert. Dem lingusitic turn folgen weitere turns, darunter auch der cultural turn. Mit der kulturwissenschaftlichen Wende verschiebt sich das Verständnis von Kultur in Richtung eines sozialkonstruktivistischen Konzepts, dem der oben beschriebene wissens- bzw. bedeutungsorientierte Kulturbegriff zugrunde liegt.
Nach der hier vertretenen Auffassung zeigt sich ‘Kultur’ demzufolge nicht primär im Verhalten, das durch vorbewusste Prägungen gesteuert wird. Vielmehr entsteht sie dort, wo Sinn zugeschrieben und interagiert wird – also im symbolischen Handeln. Die wichtigste Form dieses Handelns ist Sprache. Dabei geht es nicht um Sprache als System aus Grammatik und Wortschatz, sondern um ihren Gebrauch im Diskurs. Jede sprachliche Äußerung, jeder Text und jede Interaktion nutzen die symbolische Ordnung, die wir als ‘Kultur’ verstehen. Dies setzt voraus, dass die Beteiligten nicht nur dieselbe Sprache sprechen, sondern auch über geteiltes Wissen verfügen, das als selbstverständlich gilt. Nehmen wir als Beispiel das Thema Fußball. Stecke ich nicht im Fußballdiskurs, d.h. ich interessiere mich nur marginal für dieses Thema, werde ich Gesprächen darüber auch nicht wirklich folgen, geschweige denn, mich daran beteiligen können. Da Sprache, mündliche Äußerungen, Texte, Bilder und Medien den kulturellen Austausch prägen, ist der Diskurs der zentrale Zugang zur Erforschung von Kultur (siehe hierzu auch Altmayer 2013)
Etwas einfacher und zugleich anschaulicher drücken es die beiden Ethnologinnen Joana Breidenbach und Ina Zukrigl aus, die sagen, Kultur sei „ein Prozess, durch den Menschen der Welt, in der sie leben, einen Sinn geben“ (Breidenbach / Zukrigl 2002: 24).
2.2 Sprache und Kultur
Wenn wir über Kultur sprechen, ist damit – wie wir bereits gesehen haben – also nicht einfach gemeint, dass Menschen aus verschiedenen Ländern sich zwangsläufig unterschiedlich verhalten, oder dass sich Menschen aus dem gleichen Land immer gleich verhalten. Viel interessanter, gerade und auch für VA ist doch die Frage, wie Kultur eigentlich mit Sprache und eben nicht mit Nationalität zusammenhängt.

Gehen wir von nun also von einem wissens- und bedeutungsorientierten Kulturbegriff aus, so heißt das, ‘Kultur’ findet im Sprachgebrauch und in Diskursen statt, und gibt uns Sinn, Verständnis und Orientierung. Das Repertoire an Bedeutungen ermöglicht es Gegenstände, Situationen und Handlungen als sinnvoll wahrzunehmen. Somit ist Kultur ein sprachlich-diskursives und KEIN homogenes, essenzielles und territorial determinierendes Konstrukt, das sich auf Länder oder Nationen beschränkt.
In der Sprache transportieren wir also Bedeutung – und diese Bedeutung kann individuell und subjektiv sein, aber oft, wenn nicht sogar meistens, ist sie auch kollektiv. Das heißt, die Bedeutung, die wir in der sprachlichen Kommunikation ausdrücken, ist uns nicht erst in diesem Moment spontan eingefallen. Wir haben sie gelernt und wir teilen sie mit anderen, die uns dann entweder verstehen oder nicht.
‘Kultur’ ist also nicht irgendwo in einer ‘objektiv’ existierenden Wirklichkeit zu suchen, ihre Gegenstände sind vor allem sprachliche Äußerungen, mit denen wir der Wirklichkeit Bedeutung zuschreiben und mit denen wir diese als auch soziale und gemeinsame Wirklichkeit überhaupt erst herstellen. Kommen wir auf unser Einstiegsbeispiel zurück: Beim Thema ‘Essen’ geht es also nicht darum, wie oder was ‘die Deutschen’ oder ‘die Amerikaner’ oder ‘die Italiener’ essen und was nicht, es geht darum, wie wir über Essen sprechen und schreiben, und wie wir mit diesen sprachlichen Handlungen dem Thema ,Essen’ bestimmte Bedeutungen zuweisen, wie wir diese Bedeutungen in der Interaktion aushandeln und wie wir versuchen, bestimmte Bedeutungen auch durchzusetzen und zu stabilisieren.
 Beispiel: Mauer
Beispiel: Mauer
Eine Mauer ist erst einmal ein in bestimmter Form angeordneter Haufen Steine. Die Steine erhalten durch ihre Anordnung eine Bedeutung: Sie grenzen etwas ein (oder eben auch aus).
Nehmen wir nun eine konkrete Mauer als Beispiel: Die Berliner Mauer.
Die Berliner Mauer wurde von Seiten der BRD als Schandmauer, von Seiten der DDR als antifaschistischer Schutzwall bezeichnet. Dass der Steinhaufen durch Sprache hier jede Menge Deutungsspielräume eröffnet und hierbei auch einen Kampf der Diskurse um Deutungshoheiten darstellt, macht dieses anschauliche Beispiel besonders deutlich.
Auch Claire Kramsch fokussiert in ihrem Konzept der symbolischen Kompetenz die kulturelle Bedeutungsherstellung selbst:
“Today it is not sufficient for learners to know how to communicate meanings; they have to understand the practice of meaning making itself” (Kramsch 2006: 251).
2. Aufgabe:
Sehen Sie sich den Vortrag Trans-lating culture in the language classroom: An historical challenge von Claire Kramsch an und beantworten Sie gedanklich folgende Fragen dazu:
- Was heißt es, dass wir vielfache Zugehörigkeiten haben?
- Welchen Gruppen fühlen Sie sich zugehörig?
- Beschreiben Sie in ihren eigenen Worten, was Kultur ist.
3. Aufgabe:
Wie könnte man unsere Eingangsfrage anders formulieren bzw. wie könnte man mit dem Thema ,Essen’ nach dem bedeutungsorientierten Kulturbegriff weiterarbeiten?
Notieren Sie, wie Claire Kramsch das Thema vielleicht angehen würde.
Halten wir als Zwischenfazit dieses Moduls fest:
- Kultur beschränkt sich nicht auf eine Nation, sondern ist in (sprachlichen) Diskursen zu finden. (Kultur als Text)
- Wir finden Kultur also in Sprache jeglicher Form: in Texten, Bildern, Medien, mündlichen Äußerungen .
- Sprache transportiert immer auch Bedeutung.
Wir werden am Ende der Einheit noch einmal auf die Frage aus Aufgabe 3 zurückkommen. Um Ihnen noch weitere Unterstützung zu geben, werden wir uns im nächsten Kapitel kritisch mit dem nach wie vor vorherrschenden Narrativ auseinandersetzen, das Kultur mit Nation gleichzusetzen scheint.
Alle Illustrationen auf dieser Seite von @storyset (https://www.freepik.com/author/stories)
This work © 2025 by VE-Collab is licensed under CC BY-NC-ND 4.0