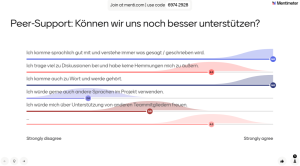2. Spielerisch lernen

Aufgabe 5:
Nachdem Sie nun schon einige Begriffe kennengelernt haben, nehmen Sie sich kurz Zeit, um folgende Fragen zu reflektieren:
a) Welche Gründe gibt es aus Ihrer Sicht, Spiele im Unterricht einzusetzen?
b) Was sind aus Ihrer Sicht Herausforderungen beim Einsatz von Spielen oder spielbasiertem Lernen im Unterricht?
2.1 To play or not to play
Wir starten diese Einheit mit der Überlegung, warum wir überhaupt Spiele im Unterricht und in der Lehre einsetzen sollten. Eine der Antworten auf diese Frage können Sie sicherlich erahnen: Spiele – selbst kleinere Einheiten – sorgen für eine Aktivierung und motivieren uns. Genauer können Spiele dafür sorgen, dass Lernende Fähigkeiten und Kompetenzen entwickeln, während sie sich darauf konzentrieren, eine Aktivität im Spiel auszuüben (EDUCAUSE Learning Initiative, 2014). Sie können flexibel eingesetzt werden: als individuelle Lernaktivitäten, über mehrere Einheiten hinaus oder einen ganzen Kurs begleitend.
Dafür ist es aber wichtig, dass vom Lernziel aus gedacht wird und sie in einer Weise unseren Ehrgeiz ansprechen. In den folgenden Bausteinen werden Sie mehr über das Potenzial, aber auch über die Herausforderungen beim Einsatz von Spielen und spielbasiertem Lernen erfahren.
2.1.1 Herausforderungen
Die Einbindung von Spielen in den Lehrkontext eröffnet spannende Möglichkeiten für die Förderung von Motivation, Engagement und Lernen. Doch wie bei jeder Lehrmethode gibt es auch hier Herausforderungen, die bedacht werden müssen, um den Einsatz effektiv und nachhaltig zu gestalten.
Ein zentrales Hindernis liegt im hohen Zeit- und Ressourcenaufwand, der mit der Entwicklung und Implementierung von Spielen einhergeht. Gut gestaltete Lernspiele erfordern sorgfältige Planung, Testphasen und Anpassungen. Dies bedeutet nicht nur einen finanziellen Aufwand, der je nach Projekt von geringen Mitteln bis hin zu kostspieligen Investitionen reicht, sondern auch den Einsatz von Fachwissen in Pädagogik, Design und Technik.
Dennoch gibt es diverse bereits erstellte und getestete Projekte, die mit leichten Änderungen an Ihr jeweiliges Projekt und Ziel angepasst und so mit geringerem Aufwand verwendet werden können:
- https://digillab.uni-augsburg.de/kursarchiv/gamification-und-digital-game-based-learning-im-unterricht/lessons/beispiele-fuer-kostenfreie-online-verfuegbare-serious-games/
- https://genially.com/de/vorlagen/spiele/bildung/
- https://www.kika.de/spiele/kinderspiele-online-kostenlos-100
- https://www.goethe.de/ins/fr/de/spr/unt/20835356.html
Auch die Akzeptanz der Lernenden stellt eine Herausforderung dar. Während Spiele für viele motivierend wirken, bevorzugen nicht alle Studierenden diesen Ansatz. Daher sollte man im Vorfeld prüfen, ob ein spielerischer Zugang zu den jeweiligen Lernzielen und Zielgruppen passt.
Wie bereits in dem Abschnitt Mythen (Kap.1.2) erwähnt, verleitet der Einsatz von Spielen in Lehrkontexten zur Annahme, dass Lernende direkt und automatisch durch das Spielen lernen. Auch denkt man, dass es sofort als Spiel gilt, wenn man spielbasierte Elemente einsetzt. Um dieser Herausforderung zu begegnen, sollten unbedingt Strategien wie Debriefing (nach dem Spiel) eingesetzt und über zuvor festgelegte Lernziele reflektier werden.
2.1.2 Potenziale
Lernspiele bieten ein großes Potenzial für die Lehre. Studien haben gezeigt, dass sie mindestens genauso effektiv wie andere interaktive Lernmethoden und deutlich wirkungsvoller als passives Lernen sind (Vogel et al., 2006; Sitzmann, 2011; Wouters et al., 2013; DeSmet et al., 2014; Clark et al., 2016). Dieses Potenzial liegt in der natürlichen Verbindung zwischen Spielen und Lernen. Wie Becker (2017) feststellt, lernen Menschen oft spielerisch. Spiele sind jedoch für uns weit mehr als nur eine Lernmethode für Kinder.
In einer Welt, in der Frontalunterricht zunehmend Schwierigkeiten hat, junge Menschen zu begeistern, stellt Game-based Learning (GBL) einen vielversprechenden Ansatz dar. Der Einfluss des Internets und die Beliebtheit von Videospielen tragen dazu bei, dass klassische Unterrichtsformen für viele Lernende weniger ansprechend wirken. GBL hingegen nutzt das Medium Spiel, um ein motivierendes Umfeld zu schaffen, das Lernende aktiviert und ihre Aufmerksamkeit erhöht.
Wie Jane McGonigal (2011) beschreibt, entsteht Motivation oft, wenn Menschen an der Grenze ihrer Fähigkeiten arbeiten – im ständigen Wechsel zwischen Herausforderung und Erfolgserlebnis. Lernspiele können diesen Zustand gezielt fördern, der in herkömmlichen Bildungssettings nur schwer zu erreichen ist. Dabei hängt die Wirksamkeit von GBL maßgeblich davon ab, wie gut das Spiel die Interessen der Lernenden anspricht, die Bedeutung des Ziels vermittelt und die Aufgaben angemessen gestaltet (Sauvé et al., 2007).
Ein ausgewogenes Maß an Komplexität ist hierbei entscheidend: Zu leichte Spiele langweilen, während zu schwere Spiele frustrieren. Gleichzeitig müssen Spiele Raum für unterschiedliche Spielertypen schaffen, z. B. durch Herausforderungen für Achievers oder soziale Interaktionen für Socializers. Allerdings besteht weiterhin Forschungsbedarf, insbesondere hinsichtlich der optimalen Aufgabenkomplexität, um sinnvolles Lernen langfristig zu ermöglichen (Qian & Clark, 2016).
Game-based Learning bietet Lehrkräften also eine Chance, Motivation und Engagement in der Lehre zu steigern – ein Ansatz, der besonders in einer digital geprägten Welt von Wert sein kann. So kann er auch gut in VA integriert werden, worauf in Kapitel 3 näher eingegangen wird.
Neben der Aktivierung von Lernenden, bietet GBL weitere zahlreiche Vorteile, die über reine Wissensvermittlung hinausgehen. Diese beziehen sich vor allem auf das Wechselspiel von Erfolg und Scheitern im Spiel. Laut dem Bericht “7 Things You Should Know About Game-Based Learning” von EDUCAUSE Learning Initiative (2014) können Spiele:
- Fähigkeiten der Lernenden schrittweise verbessern, indem sie Zwischenziele erreichen und so ein Gefühl von Fortschritt erfahren.
- Verdeutlichen, dass Misserfolge keine Rückschläge, sondern Indikatoren für weiteren Lernbedarf sind.
- Zeigen, wie einzelne Schritte zu einem größeren Ziel führen und dabei die Verbindung zwischen Taktik und Strategie aufdecken.
- Die Bedeutung alternativer Lösungswege und die Anwendung von Verfahren vermitteln.
- Lernende zu selbstbewussteren, unabhängigen Denker*innen machen, die besser darauf vorbereitet sind, große Projekte eigenständig zu bewältigen.
Spiele ermöglichen außerdem die praktische Anwendung von Wissen, indem sie Lernenden ein sicheres Umfeld bieten, in dem sie Aufgaben wiederholen können, ohne Angst vor Fehlern haben zu müssen. Dieser Ansatz stärkt die Wissensstruktur und fördert die Integration von Theorie in die Praxis (STEAMER Project, 2020).
Der MIT-Professor Scot Osterweil (2014) beschreibt in seinem Konzept der Four Freedoms of Play vier grundlegende Freiheiten, die für Spiele, und auch für das Lernen, essentiell sind:
- Die Freiheit zu scheitern: Spiele bieten die Möglichkeit, Fehler zu machen und von vorne zu beginnen. Dieser Prozess ist ein bewährter Lernmechanismus, der auf Studien seit dem 19. Jahrhundert basiert. Durch wiederholtes Scheitern erkennen und überwinden Lernende ihre Fehler.
- Die Freiheit zu erkunden: Spiele ermöglichen es, neue Wege auszuprobieren und unterschiedliche Strategien anzuwenden, um Ziele zu erreichen. Dadurch können Lernende herausfinden, welche Ansätze am besten funktionieren.
- Die Freiheit, neue Rollen auszuprobieren: Spiele erlauben es, in verschiedene Identitäten zu schlüpfen. Multiplayer-Spiele können beispielsweise Führungskompetenzen fördern und verborgene Fähigkeiten aufdecken.
- Die Freiheit des Engagements: Spiele geben die Möglichkeit, mit unterschiedlichem Tempo und je nach Motivation zu spielen.
Game-based Learning trägt nachweislich zur Entwicklung wichtiger Soft Skills bei, die für den Erfolg im 21. Jahrhundert unverzichtbar sind. Laut Qian und Clark (2016) gehören dazu:
- Kritisches Denken: Wissenschaftliches und systemisches Denken, Problemlösung und Entscheidungsfindung.
- Kreativität: Innovatives Denken, Originalität und die Fähigkeit, Fehler als Chance zu nutzen.
- Zusammenarbeit: Effektives Teamwork, Flexibilität, Kompromissbereitschaft und geteilte Verantwortung.
- Kommunikation: Klarer Ausdruck von Gedanken und der effektive Einsatz von Medien und Technologien.
Die Entwicklung dieser Fähigkeiten hängt von den Eigenschaften des Spiels ab – ob es sich um ein Multiplayer- oder Einzelspiel handelt, und ob soziale Interaktion oder Strategie im Vordergrund stehen. GBL bietet eine Vielzahl von Ansätzen, die gezielt unterschiedliche Kompetenzen fördern können.
Eine weitergehende Auseinandersetzung mit zwei aktuellen Kompetenzmodellen sowie eine kritische Einordnung finden sie auch hier.
Spiele sind ein integraler Bestandteil menschlicher Kultur und ein natürlicher Ausdruck unserer Neugier und Kreativität. Sie sind tief in unserer Lebenswelt verankert, weshalb es naheliegend ist, Spiele auch als Mittel zur Wissensvermittlung einzusetzen. Spielen ist nicht nur ein Zeitvertreib, sondern auch ein kulturelles und pädagogisches Werkzeug, das uns hilft, neue Wege des Lernens zu entdecken.
Aufgabe 6:
Lösen Sie die folgenden kurzen Aufgaben.
2.2 Einsetzen von Spielen in Lernkontexten

Wie durch die Potenziale ersichtlich, bieten Spiele also eine vielversprechende Möglichkeit, den Unterricht zu bereichern und Lernprozesse zu fördern. Doch um das Potenzial von Spielmechanismen in Lernkontexten voll auszuschöpfen, müssen einige wichtige Aspekte beachtet werden. Zunächst einmal ist es entscheidend, dass Lehrkräfte ihre Rolle im Spielprozess gut durchdenken. Mikro-Management, d.h. eine zu detaillierte Steuerung und Anweisung während des Spiels, kann den Lernprozess erheblich beeinträchtigen. Wenn Lernende zu sehr gelenkt werden, verlieren sie nicht nur den Spaß am Spiel, sondern lernen auch weniger aus den Erfahrungen, die sie darin machen. Es geht darum, den Studierenden Freiräume zu lassen, ihre eigenen Lösungen zu finden und zu experimentieren.
Gleichzeitig müssen die Herausforderungen, die in das Spiel integriert werden, mit den Fähigkeiten der Lernenden wachsen. Wenn das Spiel die Spieler nicht im ‘Fluss’ hält, also sie ständig herausfordert und motiviert, dann verliert es schnell an Effektivität. Bildungsbezogene Spiele sind besonders wirkungsvoll, wenn sie die Lernenden aktiv in den Prozess einbinden und den Schwierigkeitsgrad an ihre Entwicklung anpassen. Ein zu einfaches oder zu komplexes Spiel kann das Engagement mindern und den Lernwert des Spiels schmälern.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Spiele nicht immer als komplexe, teure Tools eingesetzt werden müssen. Auch einfache Elemente der Gamification, wie das Einführen von kleinen Wettbewerben oder das Einbinden von Geschichten in gewöhnliche Lernaktivitäten, können bereits positive Effekte auf die Motivation und das Lernen der Studierenden haben. Es muss nicht immer ein voll ausgereiftes Spiel sein, um Lernprozesse zu fördern. Bereits kleine Anpassungen können die Lernatmosphäre erheblich verändern und das Engagement der Studierenden steigern.
Doch Spiele sind nicht automatisch ein Garant für Lernerfolge. Es gibt viele verschiedene Arten von Spielen, und manche sind besser zum Lernen geeignet als andere (siehe Mythos Kap. 1.2 “Ist das ein Spiel!?”).
Spiele in den Unterricht zu integrieren, bedeutet also:
- eine durchdachte Planung und ein feines Gespür für die Bedürfnisse der Lernenden.
- die Gestaltung eines Spiels, das die Lernziele unterstützt, die Studierenden motiviert und sie gleichzeitig aktiv in den Lernprozess einbindet.
- eine mögliche Steigerung des Engagements sowie des langfristigen Lernerfolgs der Studierenden, indem Sie das Spiel als Werkzeug nutzen, das den Lernprozess unterstützt.
Alle Illustrationen auf dieser Seite von @storyset (https://www.freepik.com/author/stories)
This work © 2025 by Sina Werner is licensed under CC BY-NC-ND 4.0